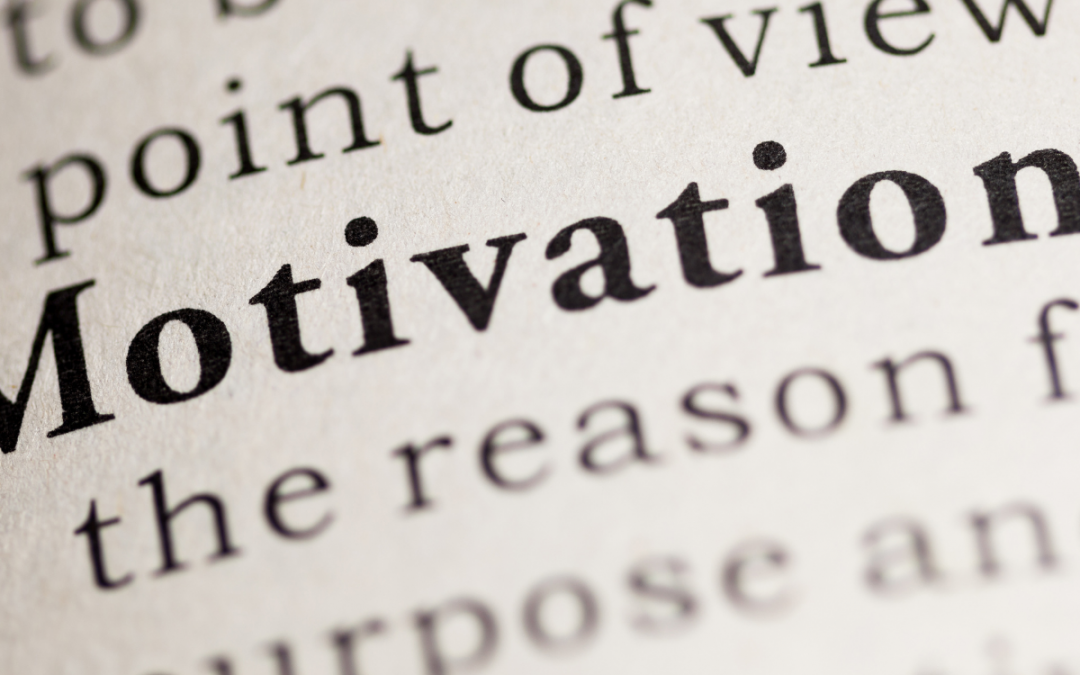Motivation von Mitarbeitern: Wie das Wissen über Motive und Werte hilft
Als Führungskräfte wünschen wir uns, dass Mitarbeitende nicht nur funktional, sondern auch emotional hinter ihren Aufgaben stehen. Es geht darum, die Motivation von Mitarbeitern zu verbessern und die Arbeitsfreude zu erhöhen. Freude an der Arbeit ist ein zentraler Ausdruck intrinsischer Motivation. Diese Form der Motivation trägt zur inneren Zufriedenheit bei und erhöht die Arbeitsleistung.
Daher fördert das fundierte Wissen über Motive und Werte die Mitarbeitermotivation erheblich. Denn so können sowohl die Interessen der Mitarbeitenden und die des Unternehmens bestmöglich in Einklang gebraucht werden.
Eine wissenschaftlich fundierte Methode, die Motive zu messen, stellt die Motivationspotenzialanalyse (MPA) dar. Sie misst die Stärke von 26 Motiven mittels einer emotionsbasierten Messung.
Das Hauptziel der MPA ist es, die Faktoren der intrinsischen Motivation der Mitarbeitenden zu erkennen und zu fördern. Aus einer Vielzahl von Motivationskonzepten nimmt die MPA einen besonderen Platz ein, weil sie die Integration von Wissenschaft und Praxis bietet. Mit ihr ist möglich, im individuellen Kontext den Einfluss der Motive z. B. auf die Kommunikation und die Führung zu reflektieren.
Deshalb es ist wertvoll, dieses Konzept auf breiter Basis in der Führung anzuwenden und damit die Motivation von Mitarbeitern zu steigern.
Motive, Motivation und Werte – wichtige Faktoren für unser Verhalten
Zunächst wollen wir die Begriffe Motiv, Motivation und Wert klären:
- Ein Motiv stellt die verfügbare Handlungsenergie bereit. Es ist ein unspezifischer Beweggrund für Verhalten.
- Motivation ist die Energie, die durch kontextbezogene Anregung entsteht. Diese Energie mündet in Handlungen zur Verbesserung des psychologischen Befindens.
- Ein Wert dient der individuellen Orientierung für attraktives Verhalten
Das Motivationspotenzial wird durch einen oder mehrere geeignete Anreize aktiviert, sodass Handlungsenergie entsteht. Die Aktivierung eines Motivationspotenzials erfolgt dabei nicht zufällig. Wenn ein Motiv stark ist, sucht der Mensch Situationen, in denen er Motivationspotenziale ausleben kann.
Im sichtbaren Verhalten spiegeln sich weitere Aspekte der Persönlichkeit wider, wie individuelle Werte, Kompetenzen und Erfahrungen. Die Anreize, die das Motivationspotenzial aktivieren, können von Person zu Person variieren. Ein bestimmter Anreiz kann bei Person A das Motivationspotenzial stark aktivieren, während er bei Person B kaum eine Wirkung hat.
Wissenschaftlich definiert sind Anreize besondere Situationen, die von der jeweiligen Person mit der Möglichkeit assoziiert werden, ein Motiv zu befriedigen. Prof. Dr. Gerald Hüther [3] und Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer [2], die renommierten Neurowissenschaftler, betonen die Bedeutung von Emotion und Wohlgefühl, wenn es darum geht, zu erklären, warum Menschen so handeln und entscheiden, wie sie es tun. Jedes Verhalten, das eines oder mehrere Ihrer Motive befriedigt, führt zu mehr innerem psychobiologischem Wohlbefinden.
Motivation ist also kein Zufallsphänomen, da Menschen Bedingungen suchen oder schaffen, in denen sie ihre individuellen Motive aktivieren und ausleben können. Das Ziel des Verhaltens ist es immer, ein inneres Wohlgefühl zu erreichen oder, wenn es bereits besteht, dieses zu stabilisieren.
Motivation von Mitarbeitern mithilfe von Motiven und Werten
Zurück in den Unternehmenskontext: In manchen Unternehmen existieren Leitbilder, die in der Praxis aber nicht befolgt werden. Dies kann zum einen daran liegen, das sich nicht alle an den Werten orientieren und ihr Verhalten danach ausrichten. Darüber hinaus schaffen die festgelegten Werte alleine keine Motivation. Motive spielen neben Werten eine wesentliche Rolle, die das Verhalten beeinflussen. Die Motivation, sich auf eine bestimmte Weise zu verhalten, entsteht nicht durch rationale Überlegungen, da Motivation eine pure Emotion ist. Es ist kein bewusster Prozess, sondern entwickelt sich durch emotionale Anreize in bestimmten Kontexten.
Deswegen ist wichtig, dass Motive und Werte immer gleichzeitig zu betrachten.
Motive können als stabiler Bestandteil der Persönlichkeit angesehen werden. Wenn jemand z. B. ein starkes Motiv Kontakt hat, d. h. das ein starkes Streben nach emotionaler Nähe zu anderen, ändert sich dies nicht über die Jahre. Es ist unabhängig vom Alter. Doch nicht jede Situation ist für das Motiv Kontakt emotional attraktiv. Wenn Sie z. B. beruflich einer Aufgabe nachgehen müssen, in der Sie alleine arbeiten müssen, werden Sie sich höchstwahrscheinlich nach einiger Zeit unwohl fühlen. Denn diese Situation spricht das Motiv Kontakt emotional nicht an.
Darüber hinaus spielen auch Werte in einer Situation eine Rolle. Denn wir orientieren uns je nach Situation an unterschiedlichen Werten. Unabhängig von einem starken Motiv „Kontakt“, könnten Sie sich z. B. in der Familie an dem Wert Fürsorge orientieren, bei der Arbeit an den Werten Effizienz und Effektivität. Wie sich in der Situation verhalten, hängt von den Werten ab, die Sie in der jeweiligen Situation als wichtig erachten.
Ihre Entscheidung, mit wem Sie Kontakt aufnehmen und wie Sie diesen gestalten, wird durch die Werte beeinflusst, die für Sie im jeweiligen Kontext relevant sind.
Ein Motiv liefert den grundsätzlichen Beweggrund für attraktives Verhalten. Die Werte konkretisieren die Richtung und die Art und Weise dieses Verhaltens.
Praktischer Nutzen für die Motivation von Mitarbeitern
Um die Motivation der Mitarbeitenden zu erhöhen, ist es unerlässlich die dahinterstehenden Motive zu verstehen. Wenn Sie als Führungskraft verstehen wollen, welche Motive das Verhalten des Personals in einer spezifischen Situation beeinflusst haben, benötigen Sie folgende Informationen:
- wissen darüber, was ein Motiv ist,
- eine Struktur zur Unterscheidung von Motiven, wie z.B. die 26 Motive der MotivationsPotenzialAnalyse (MPA).
Mit den Ergebnissen der MPA sind Sie sowohl als Führungskraft als auch als Mitarbeitender in der Lage, zu spüren und zu reflektieren, welche Tätigkeiten eine hohe Motivation und damit eine hohe Leistung hervorrufen. Sie können reflektieren, welche Motive ihr Verhalten in einer bestimmten Situation beeinflusst haben und an welchen Werten Sie sich mit Ihrer Handlung orientiert haben.
Dieses Wissen können Sie auch in Change-Prozessen oder bei der Personal-Auswahl nutzen. Berücksichtigen Sie die Motivstrukturen der Mitarbeitenden, so können Sie sie mit emotional ansprechender Nutzenkommunikation erreichen. Bei der Personal-Auswahl treffen Sie mit dem Wissen um Motive und Werte treffen Sie einfach bessere Entscheidungen. Denn Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass damit die richtige Person am richtigen Platz einsetzen.
Sie möchten mehr über die MotivationsPotenzialAnalse wissen?
Erfahren Sie hier, wie die Mitarbeitenden ihre eigenen Motive besser verstehen können. Durch die Auseinandersetzung mit ihren persönlichen Motiven und Werten können sie nicht nur ihre Entscheidungen und Handlungen besser nachvollziehen, sondern auch ihre Führungskompetenzen stärken und den Erfolg Ihres Unternehmens steigern.
Quellen:
- Die MotivationsPotenzialAnalyse Grundlegendes zur Analyse: https://www.motivation-analytics.eu/motivationspotenzialanalyse
- Pressedienst 10. März 2010: „Lernen, Motivation und Verantwortung“ mit Gehirnforscher Manfred Spitzer – Universität Oldenburg (uol.de): https://uol.de/pressemitteilungen/2010/102
- So gelingt Motivation! Mit Gehirnforscher Gerald Hüther | Auszug Rebellisch Gesund Podcastfolge – YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=oyBc-CwW8I4